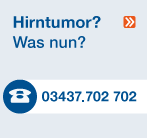Ich achte auf mich
Leben mit der Diagnose Hirntumor

Hallo! Mein Name ist Patrick. Im Jahr 2014, ich war 26 Jahre alt, erhielt ich die Diagnose Hirntumor.
Zu dieser Zeit absolvierte ich gerade ein Aufbaustudium im Bereich Soziale Arbeit und merkte seit Monaten, dass mit mir etwas nicht stimmte. Ich fühlte mich seltsam abgeschlagen, hinzu kam das merkwürdige Gefühl, dass ich mich in Gesprächen irgendwie abwesend fühlte, alles lief wie in einem merkwürdigen Film an mir vorbei. Teilweise konnte ich Konversationen gar nicht mehr richtig folgen. Was genau mir fehlte, blieb jedoch lange unklar und ich zweifelte immer stärker an mir selbst und meiner Wahrnehmung. Ich wurde von Facharzt zu Facharzt geschickt. Der Marathon durch die verschiedenen Praxen hielt Diagnosen von Depression bis Burnout für mich bereit – und das, obwohl ich mich weder traurig, bedrückt oder gestresst und überfordert fühlte. Ich war kurz davor, zu resignieren und mich selbst einfach für verrückt zu erklären.
Nach monatelanger Odysee hatte ich endlich eine Ärztin gefunden, die mir Überweisungen für diverse weitere, spezifischere Untersuchungen ausstellte. Neben einem Herz-Ultraschall, Schilddrüsendiagnostik und weiteren Maßnahmen sollte ganz zum Schluss auch ein Schädel-MRT angefertigt werden. Bis dahin waren sämtliche Werte unauffällig geblieben.
Ein weißer Fleck
Die MRT-Bildgebung wurde ambulant in einer Radiologischen Praxis durchgeführt. Im Anschluss an die Untersuchung erhielt ich den knappen Hinweis, dass ich dringend einen Arzt aufsuchen solle. Dazu wurden mir ohne weitere Erklärungen die angefertigten Bilder in die Hand gedrückt, ich verließ die Praxis – und natürlich sah ich mir auf dem Heimweg die Aufnahmen an. Auf den Bildern war ein riesiger weißer Fleck in meinem Kopf zu sehen. Auch ohne ärztliche Ausbildung wusste ich sofort, dass das nichts Gutes bedeuten konnte. Ich war wie paralysiert. Zu Hause in meiner Wohngemeinschaft angekommen, zog ich mich sofort in mein Zimmer zurück. Später sprach ich mit meinen Mitbewohnern, zeigte ihnen die Aufnahmen mit dem weißen Fleck. Sie versuchten noch halbherzig, mich zu beruhigen – womöglich sei das was ganz anderes, noch sei doch gar nichts gesagt. Doch im Grunde wussten wir alle, dass nichts mehr wie zuvor war. Ich fühlte mich in diesen Stunden nicht einmal besonders traurig oder wütend, ich war merkwürdig erleichtert darüber, endlich zu wissen, was los ist. Am Montag fuhr ich zu meiner Hausärztin in die Stadt nahe meines Heimatortes, ich wollte in der Nähe meiner Familie sein. Im Gepäck hatte ich die MRT-Bilder. Nach Sichtung der Aufnahmen sagte die Ärztin mir, was ich eigentlich schon wusste – dass ich einen Hirntumor habe. Ob gut- oder bösartig, sei so nicht erkennbar.
Die schwerste Aufgabe meines Lebens
Anschließend hatte ich die schwerste Aufgabe meines Lebens: Ich musste meiner Familie erklären, was los ist. Auf der Fahrt in meinen Heimatort übermannten mich meine Gefühle, es flossen Tränen. Warum jetzt, warum ich? Zu Hause angekommen traf ich auf meine Großeltern, die mich fragten, warum ich weine. "Weil ich sterbe!", platzte ich verzweifelt heraus, zeigte und erklärte ihnen die Bilder. Obwohl ihnen der Schrecken ins Gesicht geschrieben stand, versuchten sie sofort, mir Mut zuzusprechen. Als schließlich meine Mutter von der Arbeit kam, musste ich auch ihr alles erzählen und versuchte alles, was die Ärztin mir bislang gesagt hatte, so genau wie möglich wiederzugeben. Ich wusste, dass sie immer an meiner Seite sein würde. Am nächsten Tag hatte ich bereits den Termin im Tumorzentrum, wohin meine Mutter mich begleitete. Der Chefarzt schaute sich die Bilder an und sagte sofort, dass eine Operation unbedingt nötig sei. Glücklicherweise wuchs der Tumor nicht diffus in andere Gehirnregionen und lag für den Eingriff nicht ungünstig rechts im Frontalhirn – ein Glück im Unglück! Ich zögerte keine Sekunde und stimmte dem Eingriff zu.

Ich hatte eine Woche Zeit, um mich auf den Termin vorzubereiten. In diesen Tagen unternahm ich viel mit Freunden und meiner Familie. Ich brauchte aber auch Ruhe, um körperlich fit in die OP zu gehen. Die Tage vergingen rasend schnell, ich wurde immer nervöser. Gleichzeitig hatte ich Vertrauen in die Ärzte des Tumorzentrums gefasst. Den Abend vorm „Check-In“ ins Krankenhaus verbrachte ich zunächst mit meiner Mutter, später besuchte ich noch einem Kumpel. Meiner Mutter fiel es sichtlich schwer, mich an diesem Abend gehen zu lassen.
Risiken? Nebensache
Ich hatte kaum geschlafen, als ich mich schließlich morgens um 7 Uhr in der Neurochirurgie vorstellte. Um 8 Uhr begann die Prozedur. Meine Blutwerte wurden kontrolliert – alles in Ordnung für den anstehenden Eingriff. Das obligatorische Aufklärungsgespräch führte ein sehr netter Assistenzarzt mit mir. Im Verlauf des Tages schaute auch der Chefarzt nochmal persönlich an meinem Bett vorbei und machte mir Mut. Es war ein merkwürdiges Gefühl, unterschreiben zu müssen, dass ich das Risiko in Kauf nehme, linksseitig gelähmt bleiben zu können. Doch in meiner Situation erschien auch diese Möglichkeit plötzlich nebensächlich. Familie und Freunde waren den ganzen Tag an meiner Seite: Meine Mutter und mein Vater vor Ort, die anderen in ermutigenden Kurznachrichten, Telefonaten, e-Mails. Auch mit meinen Zimmergenossen konnte ich mich noch etwas unterhalten. Am nächsten Morgen war es so dann soweit. Die Augenblicke vor der OP fühlten sich merkwürdig an. Die Beruhigungstablette wirkte gut: Ich verspürte tatsächlich keine Angst, eher einen inneren Drang, dass es endlich losgehen möge und ich alles so schnell wie möglich hinter mir haben würde. Endlich brachte mich eine Schwester in den OP-Saal. Auf der kalten Metallliege wurde ich „verkabelt“, der Anästhesist setzte mir die Maske auf...