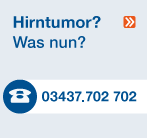Ich warte nicht mehr auf später
Interview mit Elena Semechin
Jetzt spenden! Hier geht es zur Onlinespende (Bankeinzug und PayPal).
Weltmeisterin und Gold bei den Paralympics – Elena Semechin ist eine Gewinnerin, trotz Sehbehinderung und Hirntumor. Eine beeindruckende Athletin, die ihren Weg geht und die Deutsche Hirntumorhilfe unterstützt.
Schon dreimal wurde die Schwimmerin Elena Semechin Para-Weltmeisterin über 100 Meter Brust, ebenfalls Gold holte sie sich bei den Paralympics 2021 in Tokio und 2024 in Paris. Semechin tritt als Para-Sportlerin an, weil sie eine Sehbehinderung durch die Erbkrankheit Morbus Stargardt hat, die ihre Sehkraft auf etwa zwei Prozent reduziert. Und kurz nachdem sie in Japan Gold gewonnen hatte, bekam die heute 32-Jährige die Diagnose Hirntumor. Das alles kann die beeindruckende Athletin nicht davon abhalten, ihren Weg zu gehen – sportlich wie privat. Denn im Spätsommer 2025 ist Elena Mutter geworden.
Wie geht es der jungen Familie?
Elena Semechin: Es ist super aufregend, komplett anders als vorher. Plötzlich ist ein neuer Mensch da und man muss sich komplett nach ihm richten. Das ist wunderschön und gleichzeitig natürlich anstrengend…
Was sind die größten Herausforderungen?
Ich möchte als Mutter perfekt sein. Ich möchte als Sportlerin performen und Top-Leistungen bringen. Ich möchte aber auch als Geschäftsführerin mein Unternehmen gut leiten und weiter Vorträge halten. All diese Dinge so gut es geht unter einen Hut zu bekommen, wird herausfordernd für mich. Auch sind wegen der Geburt einige Sponsoren abgesprungen, was nicht einfach ist und auch nicht nachvollziehbar…
Wann wollen Sie wieder in den Leistungssport einsteigen?
Spätestens im Sommer 2026 will ich wieder angreifen und – im besten Fall – erneut Europameisterin werden. Und langsam aber sicher werfen dann auch schon die Paralympischen Spiele 2028 in Los Angeles ihre Schatten voraus. Da will ich mich gut drauf vorbereiten…
2021 wurde bei Ihnen ein Hirntumor diagnostiziert. Wie hat er sich bemerkbar gemacht?
Im August und September 2021 nahm ich an den Paralympischen Spielen in Tokio teil. Bereits während dieser Zeit hatte ich ab und zu Kopfschmerzen und wurde von Schwindelgefühlen geplagt. Ich schob die Anzeichen aufs Klima, doch zurück in Deutschland, wurden die Kopfschmerzen immer schlimmer. Als ich sie irgendwann gar nicht mehr ertragen konnte, bin ich zum Arzt gegangen. Dies war an einem Donnerstag. Das weiß ich noch so genau, denn an diesem Tag suchten wir für unsere bevorstehende Hochzeit auch unsere Eheringe aus. Beim Arztgespräch erfuhr ich zwar, dass mit der Halswirbelsäule alles in Ordnung sei, aber mit dem Kopf etwas ganz und gar nicht stimme. Aber, was genau war es? Nur eine MRT-Diagnostik mit Kontrastmittel könne Klarheit schaffen, teilte mir mein Arzt mit. Diese Untersuchung wurde zwei Tage später veranlasst. Danach war klar, dass ich mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Hirntumor habe. Allerdings wussten die Ärzte zu diesem Zeitpunkt noch nicht, ob der Tumor gut- oder bösartig ist. Ich war wie paralysiert. Am Montag darauf fand dann bereits eine Biopsie statt. Gut, dass alles sehr schnell ging, denn so fehlte die Zeit zum Nachdenken. Bei der Biopsie wurde Tumorgewebe entnommen. Dies hat insgesamt nur eine Stunde gedauert.
Es gibt mehr als 120 verschiedene Hirntumoren. Was hat das Ergebnis der Biopsie ergeben? Welche Art von Tumor haben die Ärzte schlussendlich festgestellt?
Nach zwei langen Wochen des Wartens erhielt ich die erste Auswertung der Biopsie. Ich hatte es nun schwarz auf weiß, dass es ein Astrozytom in der linken Gehirnhälfte war. Ein Astrozytom WHO-Grad II mit Eigenschaften und Anteilen von WHO-Grad III. Die Empfehlung war: schnellstmögliche und weitestgehende Entfernung. Als Operationstermin wurde der 3. November 2021 festgelegt.
Ein chirurgischer Eingriff am Gehirn ist meist mit besonders vielen Ängsten verbunden. Wie war dies bei Ihnen?
Ich hatte furchtbare Angst. Nicht vor der Operation an sich, sondern davor, dass ich danach ein anderer Mensch sein würde. Denn da, wo der Tumor lag, befinden sich Persönlichkeits- und Sprachzentrum. Darum wollte ich in den Tagen vor der Operation gerne noch alles Mögliche unternehmen, um im übertragenen Sinn von meinem alten Leben Abschied zu nehmen. Ich war von meinen Gefühlen überrollt und äußerst verzweifelt. Aber ich wollte auch, dass die Ärzte den Tumor komplett entfernen. Und da der Neurochirurg mich gut aufklärte, hatte ich das Gefühl, dass der Eingriff die richtige Entscheidung in dieser Situation ist.
Wie verlief die Operation?
Sehr gut. Der Eingriff begann 8 Uhr. Um 16 Uhr bin ich wieder aufgewacht, und mir ging es ziemlich schnell wirklich gut. Fast hätte man denken können, es wäre nur ein schlechter Traum gewesen. Natürlich wollte ich sofort meinen Mann anrufen, was die Schwestern mir glücklicherweise erlaubten: „Hier ist die Frau Semechin.“ Er war ganz durcheinander und stammelte: „Ich bin der Herr Semechin. Was ist mit meiner Frau?“, worauf ich antwortete: „Du, ich bin es doch!“. Er konnte sich überhaupt nicht vorstellen, dass ich schon wach und so munter bin. Es war ein tolles Gefühl für uns beide, dass ich die OP so problemlos überstanden hatte.
Wie ging es Ihnen damals, als Sie erfuhren, dass Ihr Tumor noch mit Strahlen- und Chemotherapie behandelt werden soll?
Nachdem klar war, um was für einen Tumor es sich handelt, hat der Arzt etwas erwähnt, was mir vorher so gar nicht bewusst war: „Es ist eine unheilbare Erkrankung, die Sie Ihr Leben lang beschäftigen wird.“ Ich war sprachlos – mein ganzes Leben lang? Dass ich mich noch länger mit dem Thema Hirntumor auseinandersetzen müsse, damit hatte ich anfangs nicht gerechnet. Ich war ziemlich geschockt, als ich hörte, dass noch Strahlen- und Chemotherapie empfohlen werden. Diese Therapien sind aber wichtig, damit mögliche verbliebene Tumorzellen in Schach gehalten werden können. Mir gingen Gedanken durch den Kopf, dass ich meine Mitmenschen auf keinen Fall belasten möchte. Sie leiden mehr als man selbst. Gelegentlich habe ich ein schlechtes Gewissen und Angst, dass ich meinem Mann irgendwann zur Last fallen könnte.
Inwiefern verändert ein solcher Schicksalsschlag den Blick auf das eigene Leben?
Klar hätte ich mich fragen können: „Warum ich schon wieder?“, denn ich habe in meinem Leben schon einiges durchgemacht. Nach der Diagnose brauchte ich zwei, drei Tage, bis ich meine Gedanken wieder gesammelt hatte. Die Entscheidung zur Operation und die Zeit danach haben auch sehr viel Positives mit sich gebracht. Mein Leben sehe ich jetzt mit anderen Augen: Ich genieße jeden Moment, den ich erlebe, ich schätze meine Familie viel mehr und die wahren, echten Freunde, die mich begleiten. Ich lege nicht mehr alles auf die Goldwaage wie früher. Über belanglose Dinge denke ich nicht mehr nach. Ich könnte mich genauso gut zu Hause vergraben, aber was bringt das? Das Leben kann so schnell vorbei sein.
Die Erbkrankheit Morbus Stargardt ist eine Form der Makuladegeneration, die die Sehfähigkeit stark einschränkt. Wann wurde diese bei Ihnen diagnostiziert?
Meine Krankheit hat man entdeckt, als ich sieben Jahre alt war, damals lebte ich noch in Kasachstan. Es wusste aber niemand genau, was ich habe. Erst später wurde diese Erberkrankung diagnostiziert. Das Sehen hat sich über die Jahre allmählich verschlechtert. Die schlimmsten Schübe hatte ich ausgerechnet in der Pubertät, wo die Welt ja sowieso so schön ist. (Sie lacht) Ich habe mich sehr lange innerlich dagegen gewehrt und erst mit zwanzig Jahren die Erkrankung als zu mir gehörend akzeptiert.
Welche Menschen geben Ihnen in dieser schweren Zeit Halt?
In erster Linie ist dies mein Mann und jetziger Trainer Philip. Mit ihm verbringe ich die meiste Zeit. Auch mein Manager macht sehr viel für mich. Und natürlich meine Familie und Freunde. Meine Familie lebt in Kasachstan, also nicht hier. Aber aus der Ferne versuchen sie mich zu unterstützen, soweit es geht. Vergessen möchte ich auch nicht meine Follower aus der Social Media Community. Da kommen sehr viele Informationen von Menschen, die Ähnliches überlebt haben, und sie schicken sehr aufmunternde Nachrichten. Sie sagen mir, dass ich nicht allein bin, das motiviert mich und gibt mir sehr viel Kraft.
Sie haben sich dazu entschieden, die Tumordiagnose öffentlich zu machen, eine Berliner Zeitung hat sogar MRT-Bilder veröffentlicht. Warum dieser große Schritt in die Öffentlichkeit?
Ich stehe nun seit Jahren in der Öffentlichkeit und habe immer schon meinen Fans mitgeteilt, ob es gerade schlecht läuft oder gut, habe sie immer schon an meinem Leben teilhaben lassen. Als ich die Diagnose bekommen habe, war mir sofort klar, dass ich das öffentlich machen möchte, denn ich möchte auch ernste Themen mit Menschen teilen. Es gibt in der Öffentlichkeit oft nur Oberflächlichkeit, das wollte ich vermeiden. Als ich die Tumordiagose publik machte, obwohl viele dagegen waren, hat es mir sehr geholfen, damit klarzukommen. Selbst wenn es komisch klingen mag: Das war für mich wie eine Befreiung.
Die Erkrankung Hirntumor ist körperlich und auch psychisch eine große Herausforderung. Was hilft Ihnen dabei, sich auf das Wesentliche zu fokussieren?
Ich habe ein Ziel, möchte an der Para Weltmeisterschaft teilnehmen. Das ist der größte Beweggrund für mich, aufzustehen und zum Training zu gehen, selbst wenn ich mal müde bin oder mich schlechte Gedanken einholen. Und natürlich möchte ich für meine Mitmenschen stark sein und nicht Mitleid erregend herumlaufen. Das treibt mich ebenso an.
Wie gehen Sie mit Niederlagen und Rückschlägen um?
Im Grunde habe ich in meiner Sportkarriere nicht gelernt zu verlieren. Bei den Spielen in Rio 2016 habe ich verloren, weil ich mit dem Druck nicht klargekommen bin. Für mich ist damals eine Welt zusammengebrochen. Ich konnte damit überhaupt nicht umgehen. Die Niederlage zu akzeptieren, war für mich in den darauffolgenden zwei Jahren ein langer Weg. Ich glaube, in dieser Zeit habe ich etwas fürs Leben gelernt, etwas, das nicht nur meinem Sport gutgetan hat, sondern auch meiner Persönlichkeit.
Was ist denn Ihre persönliche Botschaft an Menschen, die als Patienten oder Angehörige mit der Erkrankung Hirntumor konfrontiert sind?
Was ich ihnen allen sage, ist: Es nützt nichts, sich zu Hause auf der Couch zusammenzurollen und zu fragen: „Warum gerade ich? Ich habe das doch nicht verdient.“ Ganz im Gegenteil. Besser ist es zu sagen: „Jetzt ist das so! Und jetzt ist es meine Aufgabe, den Krebs zu besiegen.“ Es ist ein Kampf, den man unbedingt mit positiven Gedanken, mit positiver Energie angehen muss. Anders schafft man das nicht, denke ich. Es ist wie beim Boxen vor dem Kampf, wenn der Boxer denken würde: „Warum soll ich da antreten?“ Das sieht der Gegner sofort und fühlt sich bereits als Sieger.
Das Interview führte Regine Cejka.
So setzen wir uns für Hirntumorpatienten und ihre Angehörigen ein
Zurück zur Startseite der Benefizaktionen