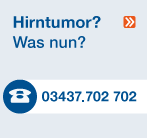Zeit der Hoffnung.
Interview mit Oli P.
Jetzt spenden! Hier geht es zur Onlinespende (Bankeinzug und PayPal).
Oliver Petszokat, besser bekannt unter dem Kürzel Oli P., ist ein Energiebündel, sprüht vor guter Laune und Allüren sind ihm fremd. Dem frühen Popstar-Rummel trauert er nicht nach, sein privates Glück sind Sohn Ilias und Ehefrau Pauline. „Sie ist mein Zuhause. Du kannst dir bestimmt vorstellen, wie groß meine Sorge war, als klar war: Der Tumor wächst.“ 2020 musste sich Pauline einer komplizierten Operation unterziehen, um einen Hirntumor zu entfernen. Bereits kurz nach der OP haben wir damals mit Oli P. gesprochen. Jetzt, gut fünf Jahre später, haben wir noch einmal nachgefragt:
Wie geht es Dir und Deiner Frau heute?
Pauline hat die Operation damals gut überstanden, und dafür sind wir immer wieder dankbar! Aber man muss wissen, dass die Genesung nach einem solchen Eingriff selten ganz geradlinig verläuft. So geht es uns bis heute: Es gibt Höhen und Tiefen. Aber was meine Frau in den vergangenen Jahren gemeistert hat, ist unvorstellbar. Und jetzt gerade geht für uns ein Traum in Erfüllung: Wir stehen gemeinsam für "Holiday On Ice" auf dem Eis. Für Pauline, als ehemalige Eiskunstläuferin, ist das ein super Comeback. Für sie ist es, nach all den Erlebnissen der letzten Jahre, wie nach Hause kommen!
Wie schafft man es, die richtige Balance zwischen Überforderung und Unterforderung zu finden?
Das ist nicht leicht. Um vorwärtszukommen, ist eine gewisse Belastung ja notwendig, damit sich der Körper den Anforderungen anpasst. Und dabei kann es passieren, dass man zu weit geht und sich dann kurzzeitig schlechter statt besser fühlt. Es ist ein Drahtseilakt, bei dem man von Tag zu Tag schauen und Geduld mit- bringen sollte. Ein Patentrezept gibt’s nicht.
Seit wann wusstet ihr von Paulines Erkrankung?
Der Hirntumor wurde vor 13 Jahren zufällig bei einer MRT-Untersuchung nach einem Sportunfall entdeckt. Es bestand zunächst kein Behandlungsbedarf, aber es wurde regelmäßig geschaut, ob sich etwas verändert. All die Jahre war alles in bester Ordnung – und dann zeigten die Bilder, dass der Tumor binnen Monaten deutlich gewachsen war und sich inzwischen sehr dicht am Sehzentrum befand. Zuvor hatte uns Paulines Erkrankung kaum beschäftigt, doch nun war plötzlich alles anders. Es musste etwas getan werden, bevor schwer behandelbare Schäden entstehen.
Wie ging es dann weiter?
Um die Entscheidungsfindung für die richtige Therapie zu erleichtern, haben wir weitere Spezialisten befragt. Die Meinung war einhellig: Alle sprachen sich für eine Operation aus. Damit war die Sache klar. Dadurch, dass der Tumor relativ langsam wächst, hatten wir den Luxus einer gewissen Vorbereitungszeit. Wir konnten in Ruhe ein für uns geeignetes Klinikum finden und den Termin in eine Phase legen, in der ich zeitlich flexibler bin als üblich.
Welche Ängste und Sorgen haben euch damals vor dem Eingriff besonders beschäftigt?
Bei der letzten Untersuchung vor der Operation war der Tumor noch einmal näher an den Sehnerv herangerückt. Am Abend vor dem Eingriff wurde uns mitgeteilt, dass Pauline nach der Tumorentfernung mit einer Blickfeldeinschränkung von 50 Prozent rechnen müsse. Auch dauerhafte motorische Einschränkungen seien möglich, abgesehen von all den anderen Risiken, die eine Hirnoperation so mit sich bringt. Auch wenn ich ein Optimist bin und der Letzte, der gern den Teufel an die Wand malt – all das hat mich nervös gemacht. Es war sehr ungewiss, in welchem Zustand ich Pauline wieder sehen würde.
Wie verlief der Eingriff damals genau?
Es ist alles gut gegangen. Die Operation dauerte knapp drei Stunden, in dieser Zeit hatte ich natürlich keine ruhige Minute. Umso größer war die Erleichterung, als Pauline aus dem Aufwachsaal auf die Intensivstation geschoben wurde und mir bereits auf dem Weg zuwinkte. Als wir kurze Zeit später miteinander sprechen konnten, sie sich mühelos artikulieren und mich einschränkungslos sehen konnte, fiel mir ein Stein vom Herzen. Die Gewebeuntersuchung ergab einige Tage später die zweite erfreuliche Nachricht: Der Tumor ist gutartig, und wir dürfen auf Genesung hoffen. Trotzdem gilt natürlich weiterhin, dass genau hingeschaut werden muss. Unter anderem führen die operationsbedingten Vernarbungen im Gehirn immer wieder zu Missempfindungen. Nach so einem Eingriff geht‘s darum, den Körper wieder neu kennenzulernen und ganz behutsam die Belastbarkeit zu steigern.
Egal wie gut eine Hirn-OP verläuft, es handelt sich um einen Eingriff, der nicht in ein paar Tagen spurlos verheilt. Du hast erwähnt, dass auch bei Pauline noch einige postoperative Einschränkungen bestehen.
Ja, das stimmt. In den ersten Tagen nach der Operation traten Geräuschwahrnehmungen auf, ein lautes Ticken im Kopf. Heute wissen wir, dass diese Nebenwirkung gar nicht so selten vorkommt. Aber als Pauline mich damals fragte, woher dieses Tick-Geräusch kommt und wir realisierten, dass nur sie es hört, war das schon etwas beängstigend. Inzwischen hat sich das wieder gelegt. Natürlich ist das belastend, aber uns ist sehr bewusst, dass wir insgesamt großes Glück hatten. Im Krankenhaus haben wir Menschen kennengelernt, die aufgrund der Art oder Lage ihres Hirntumors mit weitaus größeren Alltagseinschränkungen zurechtkommen müssen. Das geht mir nah und macht nachdenklich.
Als Partner bist du von der Erkrankung und ihren Folgen mit betroffen. Wie geht es dir damit?
Um mich muss sich in unserer Situation niemand Sorgen machen. Mir geht es gut, wir haben alles, was wir brauchen, und es macht mir Freude, für Pauline da sein zu können. Ich weiß aber auch, dass es unter anderen Umständen anders sein kann und Angehörige an ihre psychischen und körperlichen Belastungsgrenzen stoßen können. Das darf man nicht unter den Tisch kehren.
Was würdest du in diesem Fall tun?
Ich glaube, Reden ist Gold wert. Den Gefühlen einen Rahmen zu geben, Sorgen und Ängste anzusprechen, Ärger nicht herunterzuschlucken – all das hilft dabei, wieder klarer zu sehen. Man muss das ja nicht alles in der Partnerschaft austragen. Psychologische Unterstützung kann extrem hilfreich sein. Wenn man das Gefühl hat, kein Land mehr zu sehen, dann sollte man sich unbedingt Hilfe holen.
Es ist längst belegt, dass psychologische Faktoren im Genesungs- und Begleitprozess eine wichtige Rolle spielen. Dennoch zögern auch heute noch viele Patienten und Angehörige, psychoonkologische Unterstützung zu suchen.
Ja, das ist sehr schade, und ich hoffe, die Entwicklung geht weiter in die Richtung, psychologische Hilfe als das anzusehen, was sie ist: einfach ein Fachgebiet unter vielen. Wenn ich Zahnschmerzen habe, gehe ich zum Zahnarzt, wenn ich Rückenschmerzen habe, zum Orthopäden, und wenn in einer Extremsituation im Leben die Seele schmerzt, gehe ich zum Psychologen – das sollte ganz selbstverständlich sein.
Hat die Erkrankung euren Blick auf die Welt verändert?
Es ist ja häufig so, dass uns Erkrankungen aufzeigen, wie schnell scheinbar Selbstverständliches plötzlich unmöglich oder beschwerlich werden kann. Wir versuchen generell, sehr bewusst im Hier und Jetzt zu leben und im Alltag den Fokus auf das Positive zu richten. Daher würde ich nicht sagen, dass sich unsere Perspektive grundsätzlich geändert hat. Die Erkrankung hat uns eher darin bestätigt, sich auch an vermeintlich kleinen Dingen zu freuen.
Gibt es etwas, was du Menschen in einer ähnlichen Situation raten würdest?
Was ich unabhängig von einer Erkrankung jedem wünschen würde, ist, möglichst bewusst zu leben und auf sich selbst achtzugeben. Das hört sich nach Binsenweisheit an, ist aber so. Ein bisschen Bewegung; hingucken, was man isst; ausreichend Schlaf und darauf hören, was der Körper einem sagt – das ist die halbe Miete. Dazu gehört auch, Vorsorgeuntersuchungen regelmäßig wahrzunehmen. Da muss ich mir übrigens auch an die eigene Nase fassen. Ich glaube, eigentlich wissen wir ziemlich genau, was uns gut tut und was nicht. Leider schaffen wir es oft nicht, dieses Wissen auch in die Tat umzusetzen. Was ich Hirntumorpatienten und Angehörigen raten würde: Sprecht mit Leuten, die eure Situation kennen! Betreibt Erfahrungsaustausch! Es tut einfach gut, mit Menschen zu reden, die wirklich sagen können: „Ich weiß, wie sich das anfühlt.“ Auch wir haben Kontakt aufgenommen zu einer Person, die eine ähnliche Krankengeschichte hat wie Pauline und die uns insbesondere bei Rückschritten und Stagnation im Heilungsprozess sehr ermutigt.
Und ein dritter Punkt: Das eigene Tempo gehen. Wir haben uns entschieden, erst mal keine langfristigen Pläne zu machen, um Druck zu vermeiden. Das geht schon damit los, dass man das Gefühl hat, auf lieb gemeinte Nachfragen, wie es vorangeht, immer mit einer neuen „Erfolgsmeldung“ antworten zu müssen: Ja, es geht mir gut, ja, es wird immer besser usw. - denn das ist nun mal nicht immer so.
Du meinst Gedanken wie „Jetzt ist meine Operation sechs Monate her, nun muss ich sagen, dass es mir gut geht, weil es vermeintlich jeder erwartet“?
Richtig. Aber solche Erwartungen – ob es nun die eigenen sind oder die der anderen – sind natürlich Quatsch. Manchmal reicht es schon, wenn man sagt: Vielen Dank für die Nachfrage, ich weiß, ihr meint es gut – aber ihr müsst nicht jeden Tag fragen. Wartet ruhig ein bisschen, und ich melde mich, wenn es etwas Neues gibt. Solche Absprachen helfen beiden Seiten, weil sie Unsicherheiten aus dem Weg räumen.
Und da sind wir wieder beim Thema: Das tun, was gut tut?
Genau. Eine schwere Erkrankung macht die Wichtigkeit von Selbstfürsorge zwar besonders deutlich. Zu erkennen, was Körper und Seele gut tut, und zu lernen, wie man sich diese Dinge alltäglich geben kann, ist aber eine große Lebensaufgabe für uns alle.
Das Interview führte Mona Auth.
So setzen wir uns für Hirntumorpatienten und ihre Angehörigen ein
Zurück zur Startseite der Benefizaktionen