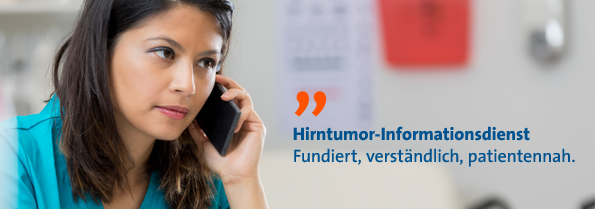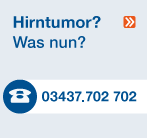Ependymom
Ependymome gehören zu den Gliomen und kommen intrakraniell, hauptsächlich aber im Spinalkanal vor. Sie entstehen aus den Zellen des Ependyms, einer Schicht, die die Hirnflüssigkeit vom Hirnnervengewebe trennt und auch den Rückenmarkskanal auskleidet.
Aktuelles aus dem Ependymom Forum
Aktuelle Beiträge zum Thema Ependymom | Antw. |
|---|---|
| Resektionshöhle Veränderungen | 2 |
| Was kommt auf mich zu? | 2 |
| Vererbbarkeit von Hirntumoren | 7 |
| Ependymom mit MYCN-Amplification behandeln? | 0 |
| Tipps und Meinungen zu vorläufiger Diagnose? | 4 |
Histologie der Ependymome
- gliale Tumoren mit ependymaler Differenzierung und typischer Rosettenstruktur
- sehr langsam wachsende Ependymome vom WHO-Grad I (myxopapilläres Ependymom und Subependymom)
- langsam wachsende, differenziert und regulär aufgebaute Ependymome vom WHO-Grad II (zelluläres, papilläres und Klarzellependymom)
- anaplastische Ependymome WHO-Grad III
Epidemiologie der Ependymome
- erster Altersgipfel im Kindesalter: im 5. Lebensjahr
- zweiter Altersgipfel im Erwachsenenalter: zwischen 30. und 40. Lebensjahr
- dritthäufigster Hirntumor im Kindesalter
Symptome der Ependymome
- variieren entsprechend der Lokalisation des Hirntumors
- durch die Lage im Ventrikelsystem mögliche Behinderung des Liquorflusses
- Hirndruckerhöhung, mitunter auch Hydrozephalus
- Hirndruckzeichen (z.B. Schwindel, Kopfschmerzen, Erbrechen)
- bei Säuglingen überwiegend Entwicklungsverzögerungen, Fallneigung
Diagnose der Ependymome
- Diagnose mittels MRT des gesamten Liquorraumes, evtl. Liquoruntersuchung
- umschriebene Läsion mit Bezug zum Ventrikelsystem
- sehr variables Kontrastmittelverhalten
- in 50% der Fälle Verkalkungen
- Hauptlokalisation: hintere Schädelgrube, Seitenventrikel und 3. Ventrikel, im Erwachsenenalter hauptsächlich im Rückenmark
- erhöhtes Risiko für Patienten mit Neurofibromatose Typ II
Therapie der Ependymome
- Operation (möglichst vollständige Resektion) des Hirntumors
- ggf. Nach-Resektion bei Tumorrest
- ggf. Teilresektion bei Hirnstamminfiltration
- Strahlentherapie nach inkompletter Resektion bzw. bei Grad-II und -III
- Bestrahlung der Neuroachse bei Aussaat in den Liquor
- Chemotherapie meist nicht angezeigt, bei Kindern und Hochrisiko-Patienten möglicherweise innerhalb von Studien
Rezidiv-Therapie der Ependymome
- Bedarf einer interdisziplinären Therapieentscheidung
- Re-Operation des Hirntumors
- (Re-)Strahlentherapie, ggf. stereotaktische Bestrahlung
- Chemotherapie als individuelle Therapieentscheidung z.B. beim Fehlen anderer Behandlungsoptionen zu erwägen
Nachsorge der Ependymome
- erste Kontrolluntersuchung 6 Wochen nach einer Therapie
- bei WHO-Grad I und II für die ersten 2 Jahre alle 6 Monate, danach alle 12 Monate
- bei WHO-Grad III alle 3 Monate sowie alle 12 Monate die gesamte Neuroachse
- Diagnostik der Wahl: MRT mit Kontrastmittel
Verlauf der Ependymome
- Ependymome mit WHO-Grad I und II: langsames, gut abgegrenztes Wachstum
- Ependymome mit WHO-Grad III: relativ schnelles, infiltratives Wachstum
- Rezidive teilweise noch nach 15 Jahren
Prognose der Ependymome
- große Unterschiede aufgrund Metastasierung, Lokalisation, Tumorrest und Alter
- vollständige Operation des Hirntumor führt zu signifikant besserer Prognose
- myxopapilläre Ependymome WHO-Grad I gelten nach vollständiger OP als geheilt