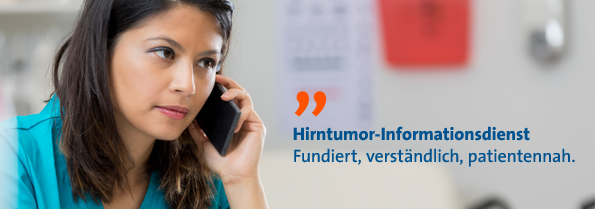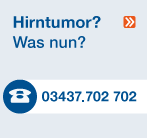Astrozytom 2
IDH-mutiertes Astrozytom WHO-Grad 2 (ehemals auch diffuses Astrozytom)
Das IDH-mutierte Astrozytom ist ein hirneigener Tumor, der aus Astrozyten hervorgeht, einer Unterart der Gliazellen im Gehirn. Gliazellen umhüllen, stützen und versorgen die Nervenzellen (Neuronen) in Gehirn und Rückenmark. Der Zusatz „IDH-mutiert“ bedeutet, dass das Isocitrat-Dehydrogenase-Gen verändert ist. Diese Mutation beeinflusst den Stoffwechsel der Zellen und ist ein entscheidendes Merkmal dieser Tumoren.
IDH-mutierte Astrozytome werden von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) anhand mikroskopischer und molekularer Eigenschaften in unterschiedliche Grade eingeteilt. Unterschieden wird zwischen den WHO-Graden 2, 3 und 4 (ein Astrozytom, IDH-mutiert WHO-Grad 1 gibt es nicht). Je höher der WHO-Grad des Tumors ist, desto höher ist dessen Zellteilungsrate und desto mehr sind auch dessen molekulare Eigenschaften verändert.
Aktuelles aus dem Astrozytom Forum
Histologie
- von Astrozyten ausgehendes Tumorgewebe
- keine mikrovaskulären Proliferationen oder Nekrosen
- 1p/19q intakt und CDKN2A/B nicht deletiert
Epidemiologie
- jährlich erkranken ca. 0,5-0,6 von 100.000 Menschen in Deutschland
- Altersgipfel liegt zwischen dem 30. und 40. Lebensjahr
- Männer sind etwa 1,5-Mal häufiger betroffen als Frauen
Symptome
- stark von der Lokalisation des Tumors abhängig
- Erstsymptom ist häufig ein epileptischer Anfall
- Hirndruckzeichen (Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit, Erbrechen, Müdigkeit)
- psychische Störungen (Persönlichkeitsveränderungen)
- neurologische Defizite ( z.B. Gefühlsstörungen, Lähmungen, Sprachstörungen)
- viele Patienten sind vor dem erstmalige Auftreten eines epileptischen Anfalls lange Zeit symptomfrei
Diagnose
- Diagnose mittels MRT mit Kontrastmittel und Gewebeanalyse (seltener CT)
- bei schwer zugänglichen oder sensiblen Tumorlokalisationen gezielte Biopsie zur Diagnosesicherung
- im MRT zeigt sich das Astrozytom Grad 2 als unscharf begrenzte Raumforderung ohne Kontrastmittelaufnahme
- teilweise auch mit geringem Marklagerödem (Schwellung durch Flüssigkeitsansammlung)
- selten Verkalkungen, Zysten und kleine kontrastmittelaufnehmende Areale
- ggfs. zusätzlich PET- und SPECT-Untersuchungen
- Hauptvorkommen: Frontal- und Temporallappen, aber auch im gesamten zentralen Nervensystem
- gehäuftes Auftreten bei Patienten mit Neurofibromatose Typ I
Therapie
- größtmögliche operative Entfernung des Hirntumor
- bei Patienten mit niedrigem Risiko:
- nach OP ggfs. zunächst “watch and wait” (Beobachtung der Krankheit ohne weitere Therapie) oder Vorasidenib (IDH-Inhibitor)
- bei höherem Risiko: Strahlentherapie und Chemotherapie
- in klinischen Studien werden weitere Therapieansätze getestet
Rezidiv-Therapie
- erneute Operation des Tumors
- (erneute) Strahlentherapie, ggfs. stereotaktische Strahlentherapie
- (erneute) Chemotherapie
- klinische Studien
Nachsorge
- frühes postoperatives MRT innerhalb von 48 Stunden nach der Operation
- erste MRT-Kontrolle nach Strahlentherapie ca. 4–6 Wochen nach Abschluss der Strahlentherapie
- alle 3-6 Monateregelmäßige MRT-Kontrollen zur Überwachung
- PET bei unklaren MRT-Befunden zur Unterscheidung zwischen Tumorwachstum und therapiebedingten Veränderungen
Verlauf
- meist lokales Wachstum mit infiltrierendem Charakter
- Neigung zum Übergang in ein höhergradiges Astrozytom Grad 3 oder 4 (Transformationsrisiko im ersten Jahr 8-9 %)
Prognose
- abhängig von Histologie, Lokalisation und Resektionsgrad des Hirntumors sowieTherapieansprechen
aktualisiert am 16.12.2024